Suttnertage 2025
Suttnertage 2025


Michael Wininger ist Psychoanalytiker/Psychotherapeut, Sozialpädagoge und Bildungswissenschaftler. Er ist derzeit interimistischer Geschäftsführer und Rektor der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten. Zuvor war er als Studienprogrammleiter am Bereich Psychotherapie der BSU und als Lektor an verschiedenen anderen Hochschulen tätig. Neben seiner universitären Tätigkeit arbeitet Michael Wininger als Psychotherapeut mit Erwachsenen in freier Praxis. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich in Lehre und Forschung mit psychosozialen Interventionsmethoden, psychoanalytischer Entwicklungstheorie sowie mit Fragen der Hochschuldidaktik und Evaluation im Bereich der universitären Bildung.
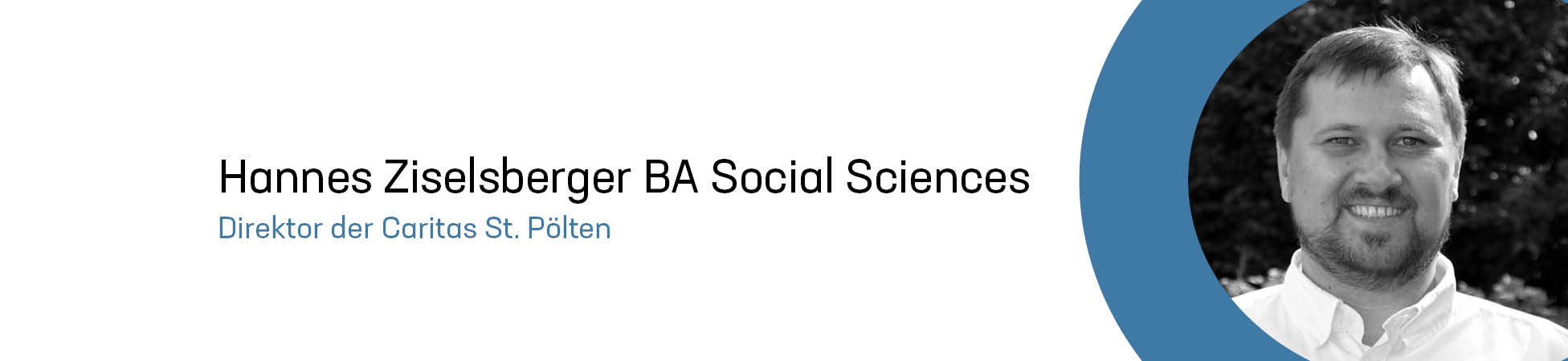
Hannes Ziselsberger ist seit 2016 Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten. Nach dem Abschluss der Handelsakademie in St. Pölten 1989 und der Ausbildung zum Milizoffizier waren die ersten Berufserfahrungen in der Sparkasse Herzogenburg, gefolgt von einem Einsatz als UNO-Soldat am Golan. Dem Studium an der WU Wien folgte von 1995 bis 2001 eine erste Anstellung bei der Caritas der Diözese St. Pölten mit dem Schwerpunkt Controlling im Bereich für Menschen mit Behinderungen. Von 2001 bis 2008 folgte die Leitungsverantwortung für die Behinderteneinrichtungen der Caritas der ED Wien in Retz. Ab 2008 Geschäftsführer im Verein Wohnen in St. Pölten mit den Schwerpunkten von Angeboten für Wohnungslose Menschen und für langzeitbeschäftigungslose Menschen. Von 2006 bis 2009 hat er die Ausbildung zum Sozialarbeiter berufsbegleitend an der FH St. Pölten absolviert.
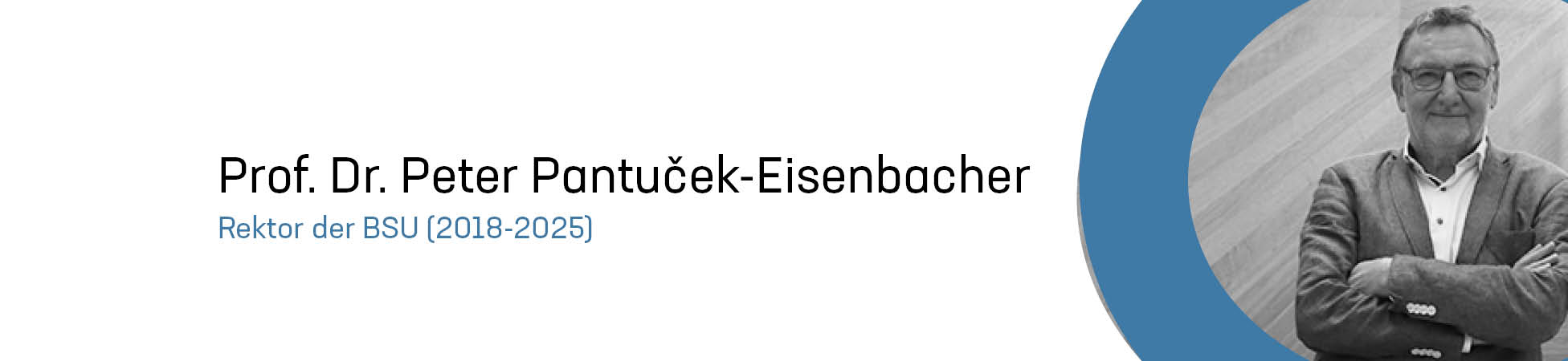
Dr. Peter Pantuček-Eisenbacher ist Sozialarbeiter, Soziologe und Supervisor. Er arbeitete am Wiener Jugendamt, an der Bundesakademie für Sozialarbeit in St. Pölten, war an der FH St. Pölten Departmentleiter Soziales und der Gründungsrektor der Bertha von Suttner Universität. Forschungsarbeit zu Sozialer Diagnostik und der Methodik der Sozialarbeit. Derzeit arbeitet er als Supervisor.
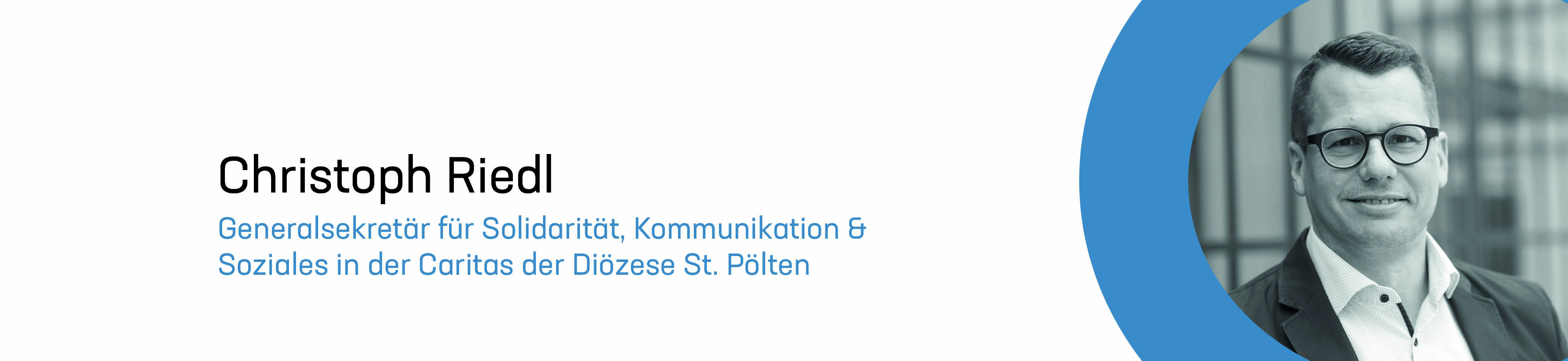
Christoph Riedl ist Generalsekretär für Solidarität, Kommunikation & Soziales in der Caritas der Diözese St. Pölten. Insgesamt arbeitet Riedl seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Kommunikation, Fernsehjournalismus, PR und Moderation - unter anderem zehn Jahre in der ORF-Religionsabteilung. Er ist außerdem Mitglied des ORF Publikumsrates.
Moderation, Tag 1 der Suttnertage.
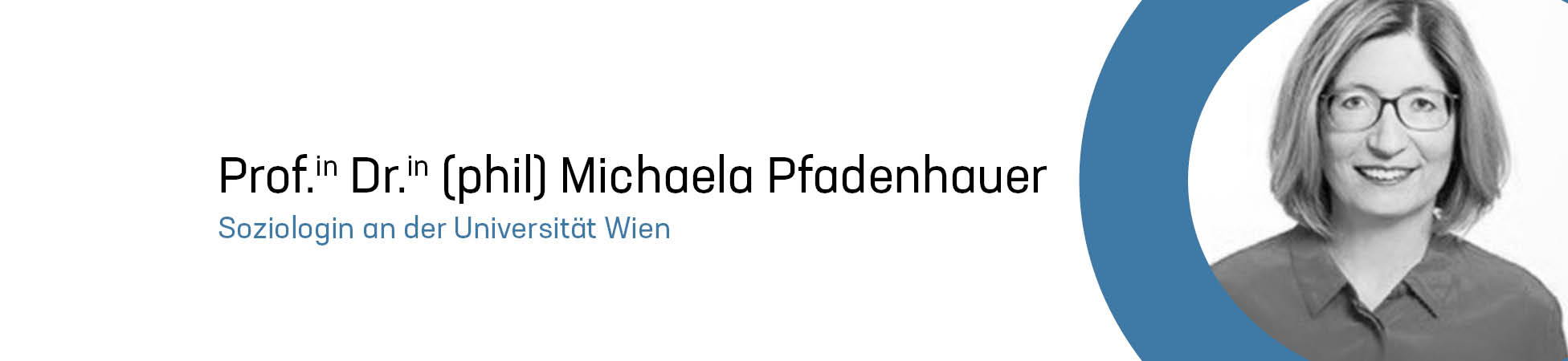
Michaela Pfadenhauer, Dr.in phil., ist seit 2014 Universitätsprofessorin für Soziologie und Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Universität Wien. Von 2007-2014 war sie Professorin für Wissenssoziologie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und hatte Gastprofessuren u.a. in Boston, Tampa und Tokyo inne. Sie forscht derzeit zur Trauerbegleitung mittels Kommunikativer KI (ComAI). Während und nach der Pandemie hat sie sich mit Wissenschaftsskepsis sowie dem Stellenwert von Professionswissen und Expertise für die Krisenbearbeitung befasst.
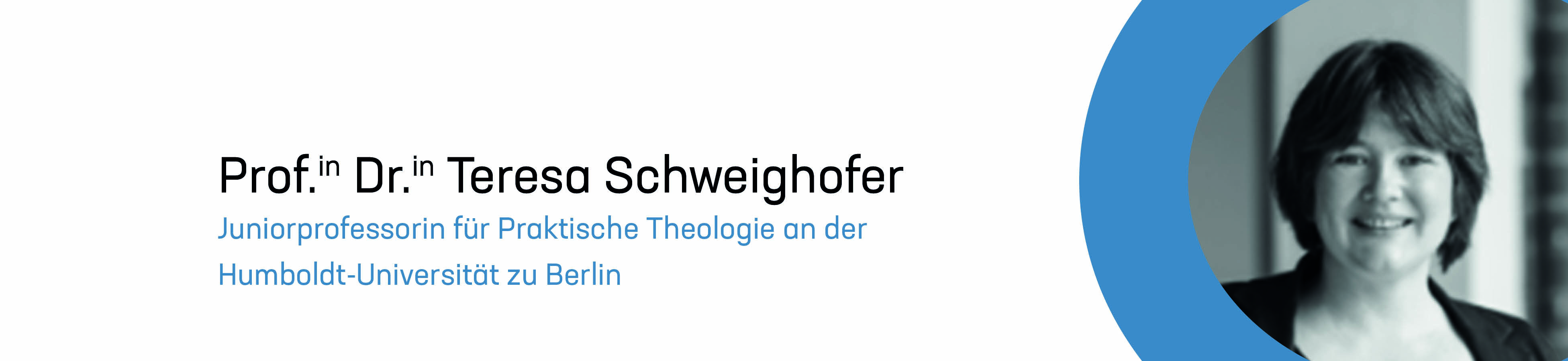
Als Juniorprofessorin für Praktische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin beschäftigt sich Prof.in Dr.in Teresa Schweighofer in ihrer Forschung unter anderem mit dem Wandel von Ritualen und Freier Ritualbegleitung sowie mit Alltagstheologien (nichtakademischen theologischen Konzeptionen).
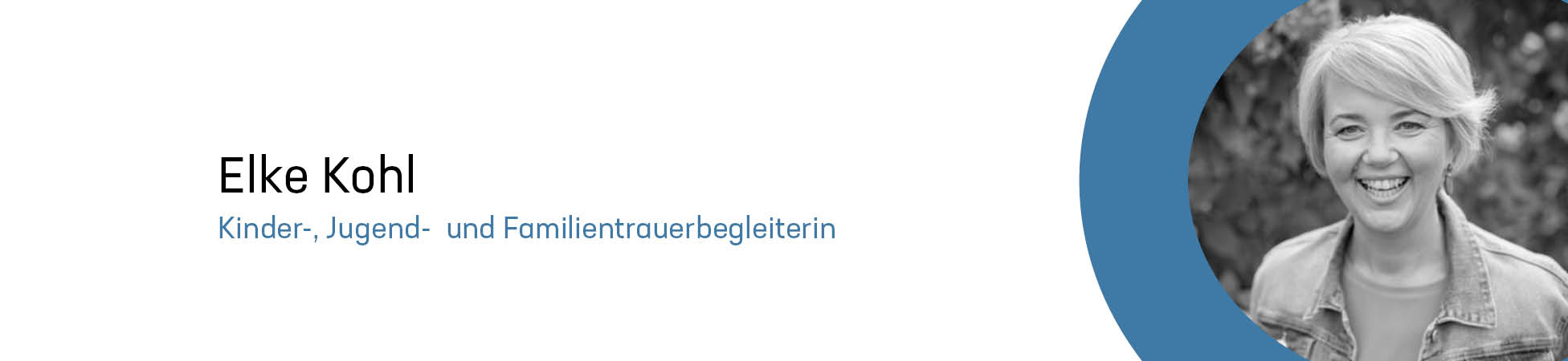
Nach vielen Jahren Tätigkeit in der Pflege, als Stationsleitung und im Mobilen Hospizdienst wechselte Elke Kohl in ihre eigene Praxis für Familientrauerbegleitung. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet sie mit Menschen jeden Alters, die von Krankheit, Trennung oder Tod betroffen sind. In St. Pölten moderiert und gestaltet sie Projekte und Trauergruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Als Referentin zu den Themenschwerpunkten Abschied, Tod und Trauer bringt sie ebenfalls jahrelange Erfahrung mit.
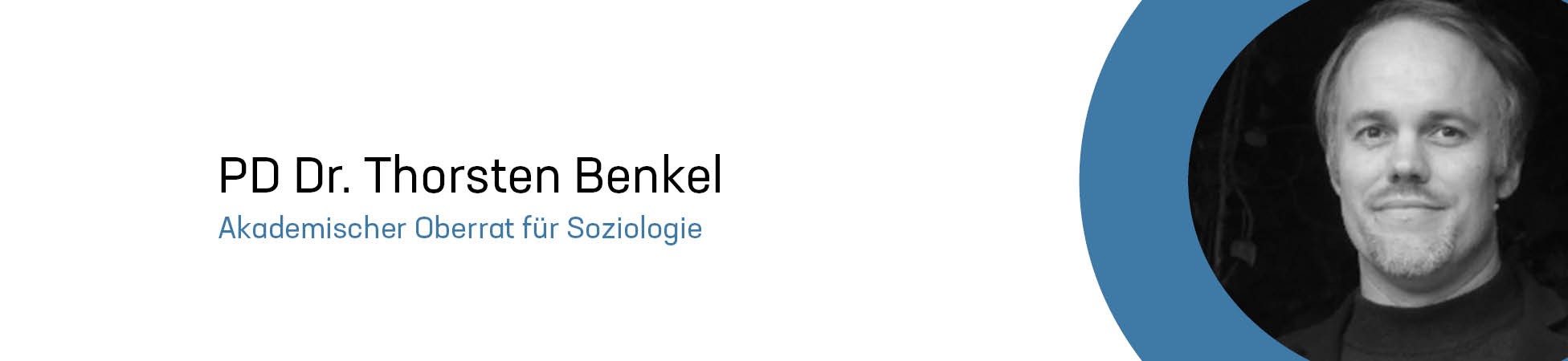
PD Dr. Thorsten Benkel ist als Akademischer Oberrat für Soziologie an der Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau tätig. Er leitet mehrere Forschungsprojekte im Bereich Sterben, Tod und Trauer und ist verantwortlich für die Schriftenreihe „Thanatologische Studien“ sowie das „Jahrbuch für Tod und Gesellschaft“. Zudem ist er Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, darunter Lebensende (2024), Sterblichkeit und Erinnerung (2022), Autonomie der Trauer (2019), Zwischen Leben und Tod (2018), Die Zukunft des Todes (2016) und Die Verwaltung des Todes (2013).
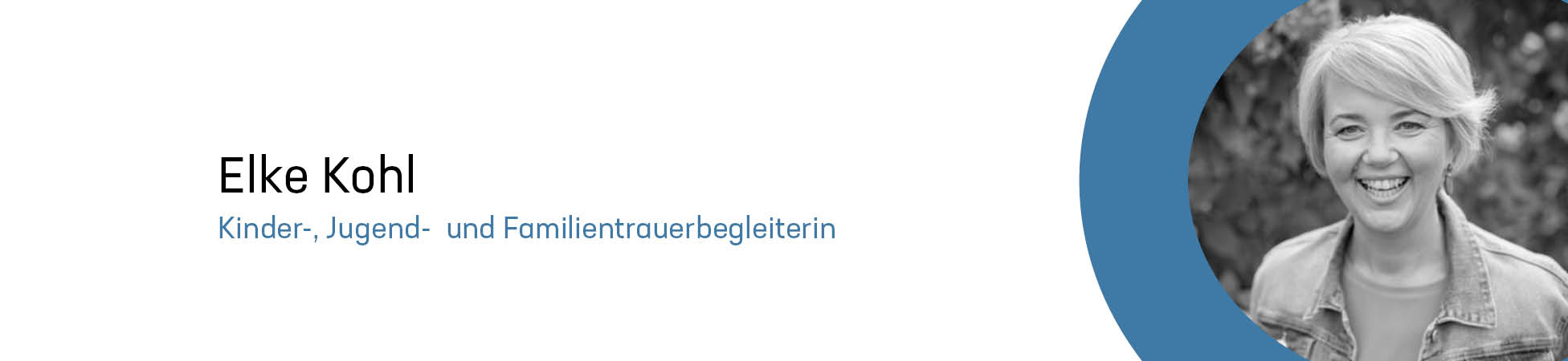
Nach vielen Jahren Tätigkeit in der Pflege, als Stationsleitung und im Mobilen Hospizdienst wechselte Elke Kohl in ihre eigene Praxis für Familientrauerbegleitung. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet sie mit Menschen jeden Alters, die von Krankheit, Trennung oder Tod betroffen sind. In St. Pölten moderiert und gestaltet sie Projekte und Trauergruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Als Referentin zu den Themenschwerpunkten Abschied, Tod und Trauer bringt sie ebenfalls jahrelange Erfahrung mit.
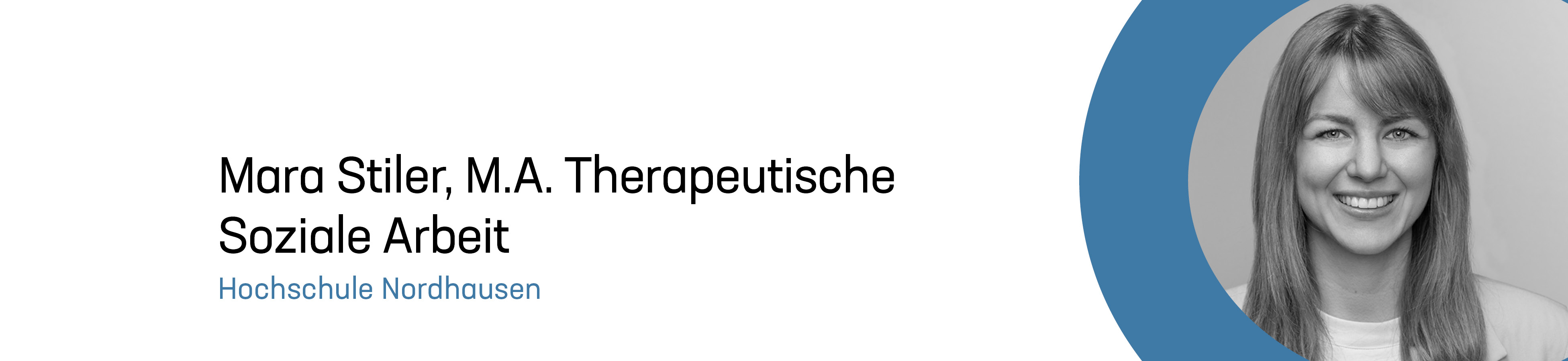
Mit langjähriger Erfahrung in der Online-Trauerberatung junger Erwachsener arbeitet Mara Stieler, M.A. seit 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für E-Beratung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Untersuchung und Evaluation digitaler Beratungsangebote mit besonderem Fokus auf Wirkweisen und professioneller Beziehungsgestaltung.

Mit 20 Jahren Erfahrung als Hebamme, spezialisiert auf die Begleitung rund um Kindsverlust und perinatale Palliative Care, hat Mag.a Dr.in (phil) Gudrun Simmer Kath. Theologie, Philosophie, Palliative Care und Organisationsethik studiert. Als freie Dozentin ist sie unter anderem an der FH Krems tätig, insbesondere in den Bereichen perinataler Kindsverlust, Medizin- und Organisationsethik sowie Partizipation. Seit Februar 2024 leitet sie den mobilen Hospizdienst der Caritas Diözese St. Pölten.
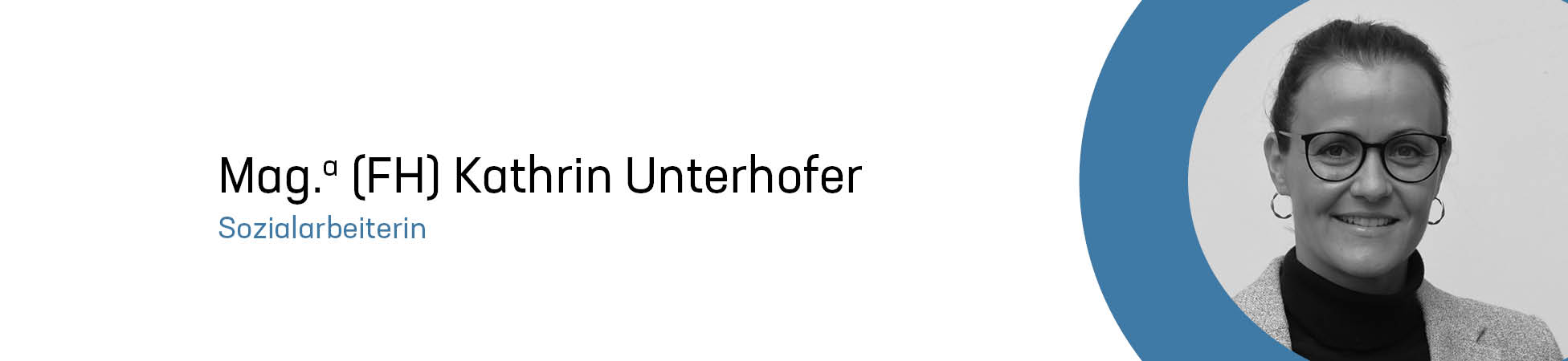
Als Leiterin der Kontaktstelle Trauer der Caritas Wien verantwortet Mag.a (FH) Kathrin Unterhofer die Leitung von Seminaren und Weiterbildungen im Bereich Trauerbegleitung. Zuvor war sie im CS Hospiz Rennweg tätig.

Dr. Kurt Alker ist Arzt für Allgemeinmedizin mit einer Spezialisierung in Palliativmedizin und bringt langjährige Erfahrung aus der Mitarbeit im Mobilen Hospiz sowie der Unterrichtstätigkeit in der SOB der Caritas Wien mit. Zudem hat er eine Ausbildung zum Trauerbegleiter an der Palliativakademie Bonn absolviert und engagiert sich ehrenamtlich in der Kontaktstelle Trauer.
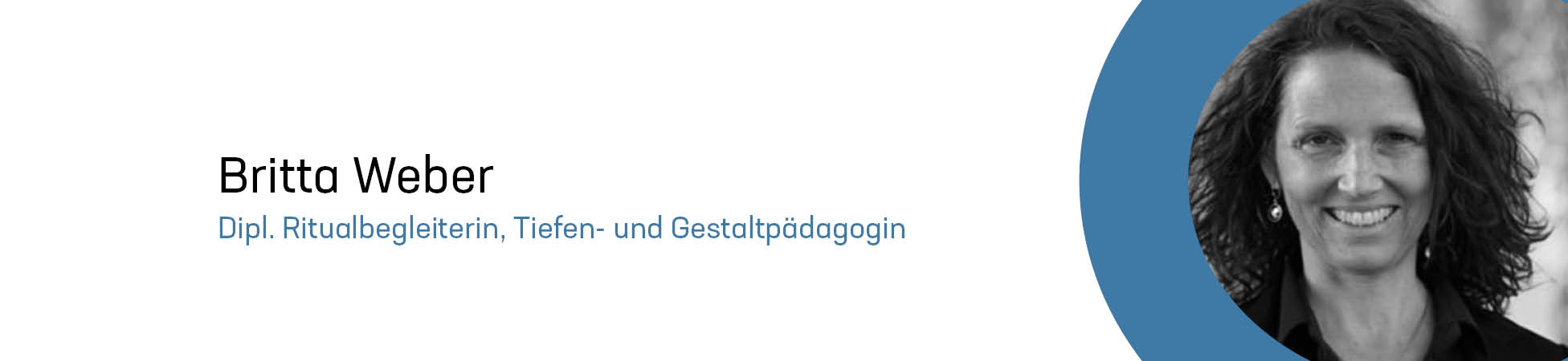
Seit 2018 arbeitet die diplomierte Ritualbegleiterin sowie Tiefen- und Gestaltpädagogin Britta Weber als freie Ritualgestalterin in Tirol. Seit 2021 ist sie zudem bei der Bestattung Neumair, Bestattungundmehr angestellt, wo sie Angehörige betreut, begleitet und Trauerfeiern gestaltet. Darüber hinaus hält sie Seminare für Institutionen wie die Innsbrucker Soziale Dienste, die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft und die Klinikseelsorge Kufstein. Ab 2025 wird sie als Lehrende an der Akademie für Ritualgestaltung tätig sein.
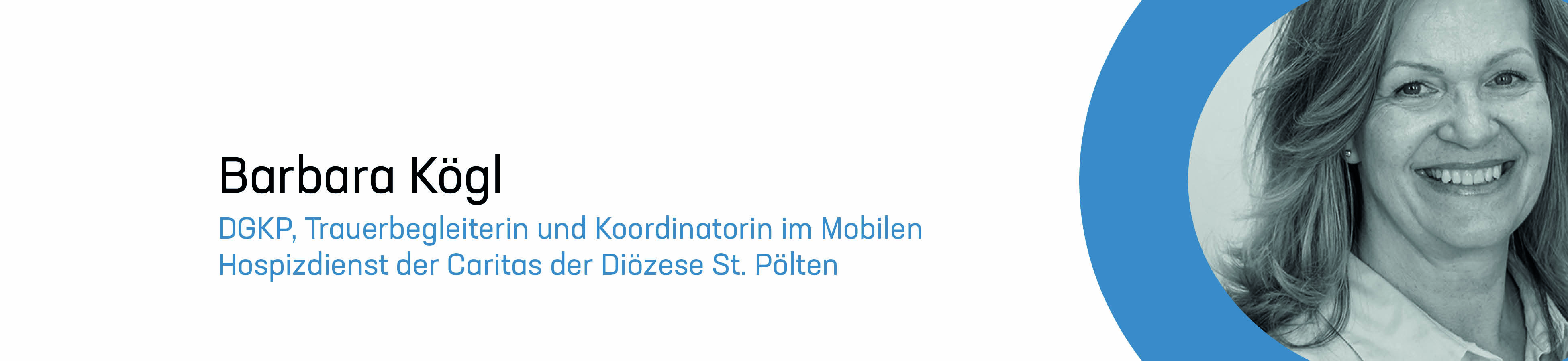
Barbara Kögl ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Palliativfachkraft sowie Trauer- und Sterbebegleiterin und Alles Clara-Beraterin. Seit 2016 koordiniert sie das Hospizteam St. Pölten Land. Zudem begleitet sie seit 2020 eine Trauergruppe für Menschen, die einen nahestehenden Menschen durch Suizid verloren haben, und organisiert seitdem auch Gedenkfeiern für diese Trauernden.
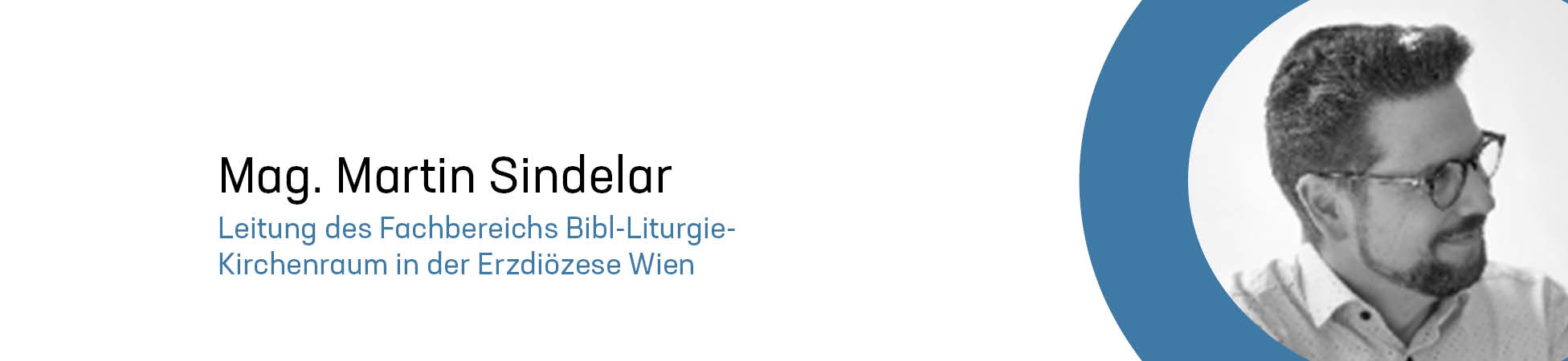
Mag. Martin Sindelar leitet den Fachbereich Bibel-Liturgie-Kirchenraum in der Erzdiözese Wien und arbeitet als selbständiger Organisationsentwickler sowie Veranstaltungsdesigner. Darüber hinaus ist er Mitglied im Beirat der BENU-Bestattung und Dozent an der Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz.
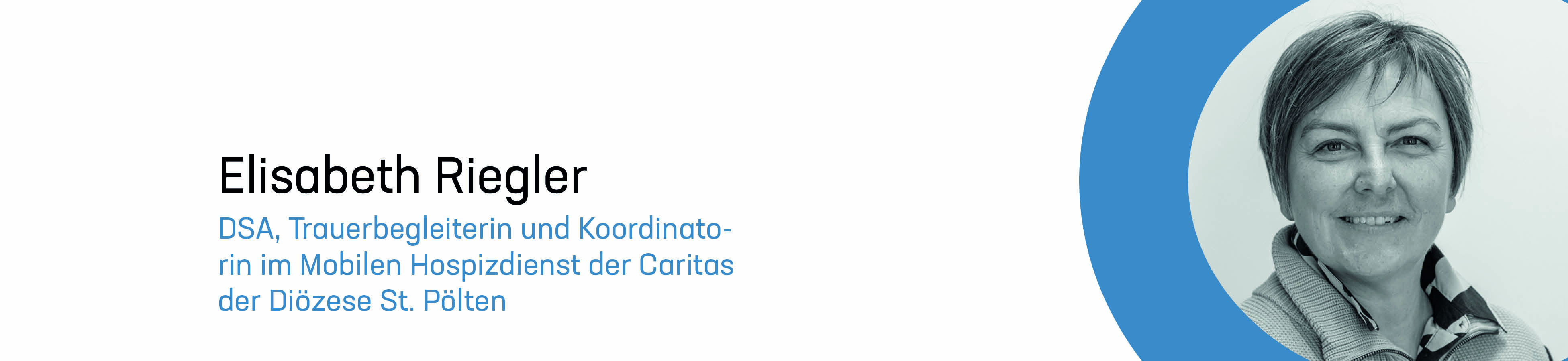
Elisabeth Riegler ist Palliativfachkraft und Trauerbegleiterin. Sie koordiniert das Mobile Hospizteam der Caritas St. Pölten für St. Pölten Stadt und leitet den Grundkurs für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung der Caritas St. Pölten. Zudem ist sie Referentin für Trauerseminare im Einführungskurs sowie im Aufbaulehrgang Trauerbegleitung.

Mit über 40-jähriger Berufstätigkeit als Hebamme, einem Studium der Pflegepädagogik an der Donau Universität Krems und ihrer Tätigkeit als Trauerbegleiterin nach Kindsverlust während der Schwangerschaft, rund um die Geburt und nach Schwangerschaftsabbruch nach schwerwiegender pränataler Diagnose, ist Renate Mitterhuber MSc vielfältig engagiert. Sie arbeitet als freie Dozentin in der Hebammenaus-, fort- und Weiterbildung sowie im Sozial- und Gesundheitsbereich, unter anderem im Rahmen der „Frühen Hilfen“. Seit 2024 nimmt sie am interprofessionellen Palliativlehrgang im Kardinal König Haus teil.
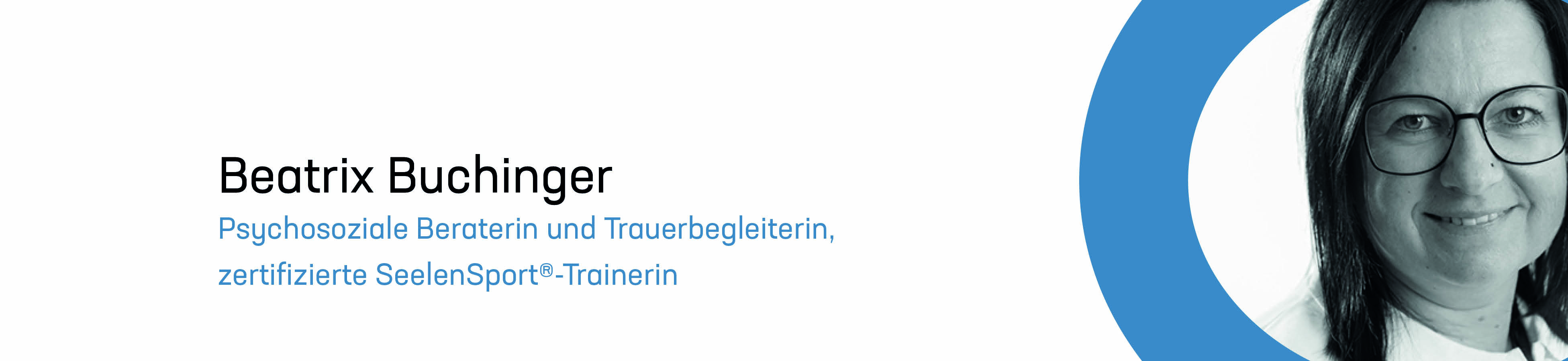
Beatrix Buchinger ist Psychosoziale Beraterin und Trauerbegleiterin (Expertenpool) in freier Praxis sowie zertifizierte SeelenSport® Trainerin. Sie hält Referate zum Thema Trauerbegleitung und Sternenkinder und leitet das Teddyhaus Linz. Sie ist Trauerbegleiterin beim Verein Herzkinder Österreich und selbst verwaiste Mutter.

- Panel 1) Du trauerst anders? Trauer und Identität
- Panel 2) Reale und virtuelle Räume des Trauerns
- Panel 3) Nicht nur Tod und Trauer: Traueranlässe im Lebenslauf
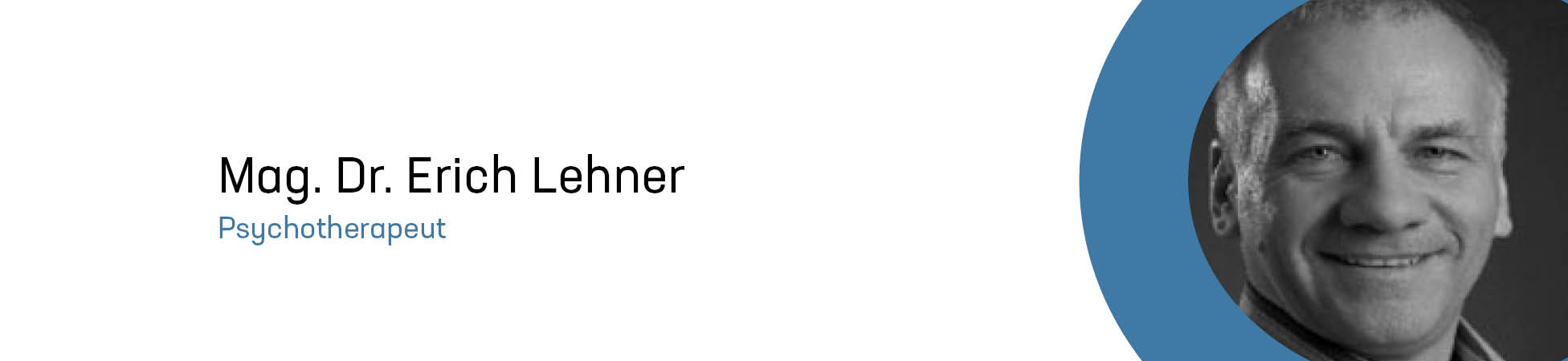
Als Psychotherapeut mit den Schwerpunkten Männer- und Geschlechterforschung sowie Palliative Care engagiert sich Mag. Dr. Erich Lehner zudem als Obmann des Dachverbands Männerarbeit Österreich (DMÖ).

Džemal Šibljaković ist Religionspädagoge, Sozialarbeiter und steht kurz vor dem Erwerb des Status als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Er leitete die Sozialabteilung der IGGÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich) sowie die islamische Gefängnisseelsorge in Österreich. In seiner Arbeit verbindet er seelsorgerische, sozialpädagogische und therapeutische Ansätze, unter anderem in der Deradikalisierungsarbeit. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt Jamal Al Khatib (Verein TURN), das einen Schwerpunkt im Online-Streetwork setzt, wozu er auch an verschiedenen Hochschulen lehrte. Derzeit bietet er selbstständig Workshops und Trainings für Jugendliche, junge Erwachsene und Multiplikator*innen im Bereich Extremismusprävention und Diversitätssensibilität an.

Seit 2007 lehrt und praktiziert Dr.in (phil) Leona Mörth-Nicola Ayurveda im Ayurveda-Verein Nexenhof sowie in ihrer eigenen Praxis. Seit 2011 ist sie Obfrau des Ayurveda-Vereins Nexenhof und seit 2016 auch Obfrau des Österreichischen Berufsverbands für Ayurveda (ÖBA). Sie studierte Religionswissenschaft an der Universität Wien und promovierte an der IFF-Fakultät der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt in Palliative Care. Zudem ist sie Yoga-Lehrerin sowie Lebens- und Sozialberaterin. Ihre Schwerpunkte liegen im Umgang mit dem Lebensende, Spiritualität und Ayurveda.
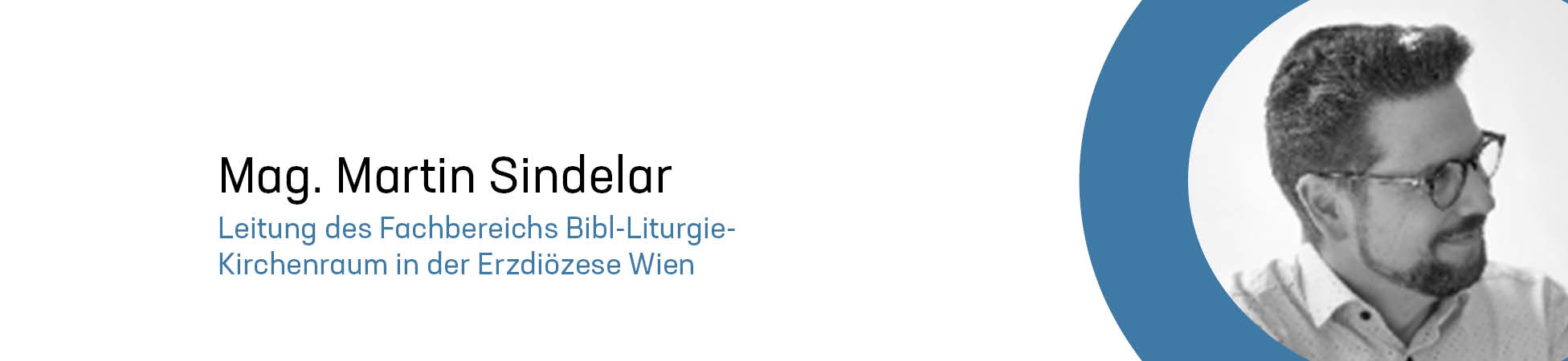
Mag. Martin Sindelar leitet den Fachbereich Bibel-Liturgie-Kirchenraum in der Erzdiözese Wien und arbeitet als selbständiger Organisationsentwickler sowie Veranstaltungsdesigner. Darüber hinaus ist er Mitglied im Beirat der BENU-Bestattung und Dozent an der Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz.
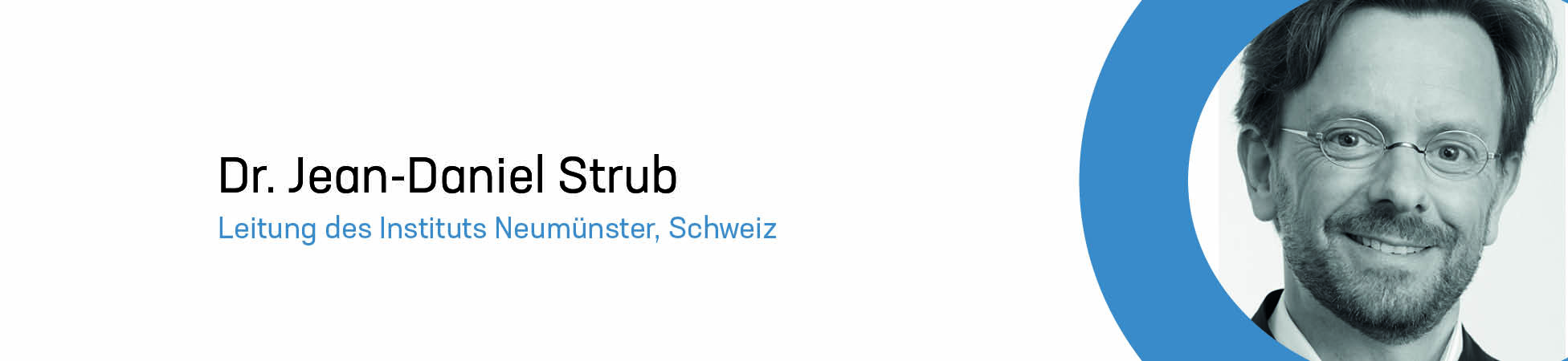
Dr. Jean-Daniel Strub leitet seit Beginn dieses Jahres das Forschungs- und Beratungsinstituts Neumünster, das in allen Bereichen des Gesundheitswesens innovative Projekte entwickelt und umsetzt. Er hat ev. Theologie studiert und am Institut für Sozialethik am Ethik-Zentrum der Universität Zürich promoviert. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind Ethik im Gesundheitswesen, Klinische Ethik, Ethische Fragen am Lebensende, Digitalisierung im Gesundheitswesen, Künstliche Intelligenz in Medizin und Pflege. Er ist u.a. Mitglied der unabhängigen Ethikkommission von EXIT Deutsche Schweiz und der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen und war in der Lokalpolitik in Zürich als Gemeinderat aktiv.
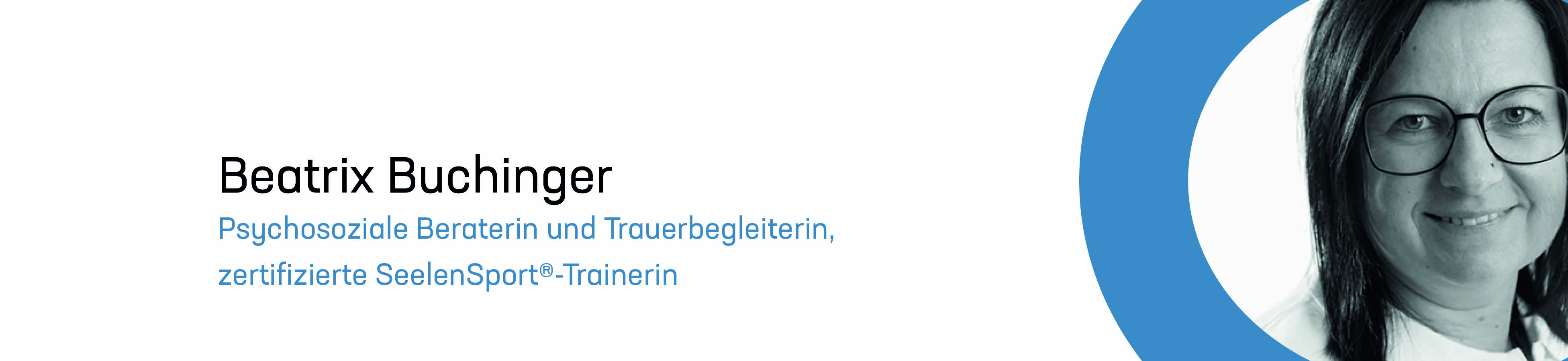
Beatrix Buchinger ist Psychosoziale Beraterin und Trauerbegleiterin (Expertenpool) in freier Praxis sowie zertifizierte SeelenSport® Trainerin. Sie hält Referate zum Thema Trauerbegleitung und Sternenkinder und leitet das Teddyhaus Linz. Sie ist Trauerbegleiterin beim Verein Herzkinder Österreich und selbst verwaiste Mutter.

Carina Györök, MSc, ist Klinische Psychologin mit Spezialisierungen in den Bereichen Psychoonkologie und Notfallpsychologie. Derzeit arbeitet sie im Liaisondienst der 1. Medizinischen Abteilung des Universitätsklinikums St. Pölten.
Ihre Schwerpunkte liegen in der psychologischen Beratung und Behandlung von ambulanten und stationären PatientInnen mit onkologischen, nephrologischen und endokrinologischen Erkrankungen.

Nach dem Psychologiestudium in Wien und einer postgradualen Ausbildung als Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe absolvierte Mag. Heinz Teufelhart eine Psychotherapieausbildung in Krems und Wien und ist als personzentrierter Psychotherapeut sowie eingetragener Mediator gemäß ZivMediatG tätig. Mit langjähriger Erfahrung im Bildungsbereich arbeitet sie derzeit in den Bereichen Beratung, Psychotherapie, Supervision und Mediation. Ihre Tätigkeit im niedergelassenen Bereich umfasst Einzel-, Paar- und Gruppensettings. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Persönlichkeitsentwicklung, Sexualität und Konflikte. Zudem berät sie im Wirtschafts- und Bildungsbereich und hält Vorträge in verschiedenen Lehrgängen, darunter der Lehrgang Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie, das psychotherapeutische Propädeutikum, Mobbingberatung und Mediationsausbildung.
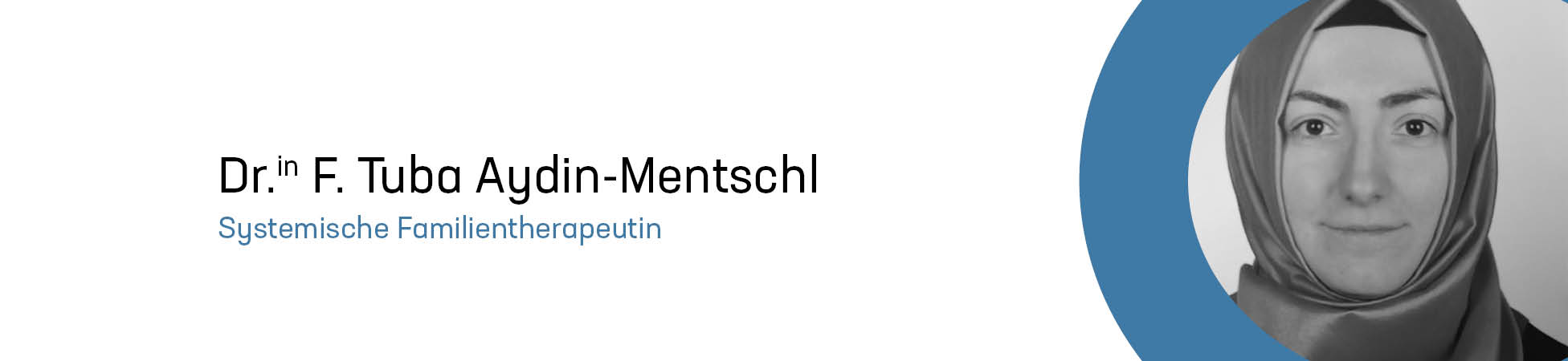
Dr.in F. Tuba Aydin-Mentschl hat Englische Literatur, Psychologie und Psychotherapiewissenschaft studiert. Ihr akademisches Interesse liegt im Bereich der Positiven Psychologie, die sie in ihre Praxis integriert. Seit 2014 ist sie als systemische Familientherapeutin tätig und hat in verschiedenen Institutionen in Wien und Wiener Neustadt gearbeitet. Derzeit ist sie beim Psychosozialen Dienst der Caritas St. Pölten tätig, wo sie Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstützt, stationäre Aufenthalte zu vermeiden und ihre Integration ins soziale Umfeld zu fördern. Zudem arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen, hilft in Krisensituationen, unterstützt bei der Veränderung von Verhaltensweisen und trägt zur Förderung der persönlichen Entwicklung und Gesundheit bei.
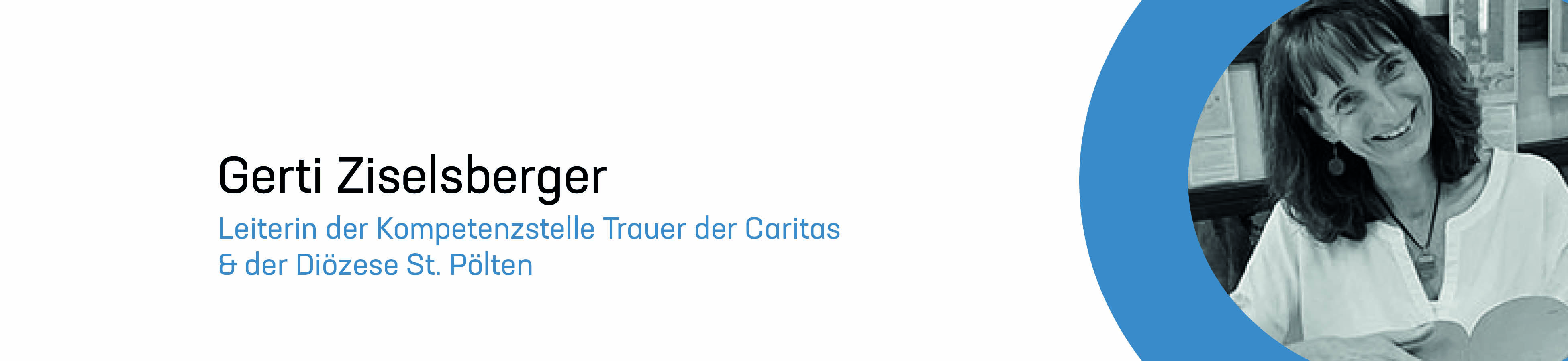
Als Leiterin der Kompetenzstelle Trauer der Caritas und der Diözese St. Pölten verantwortet Gerti Ziselsberger die Lehrgangsleitung des Aufbaulehrgangs Trauerbegleitung der Caritas der Diözese St. Pölten. Zudem ist sie als Referentin für Seminare und Weiterbildungen im Bereich Trauer tätig. Seit 2017 engagiert sie sich ehrenamtlich als Hospiz- und Trauerbegleiterin beim Mobilen Hospizdienst der Caritas. Zuvor war sie 17 Jahre lang als diplomierte Ehe-, Familien- und Lebensberaterin in der Familienberatungsstelle Rat & Hilfe tätig.
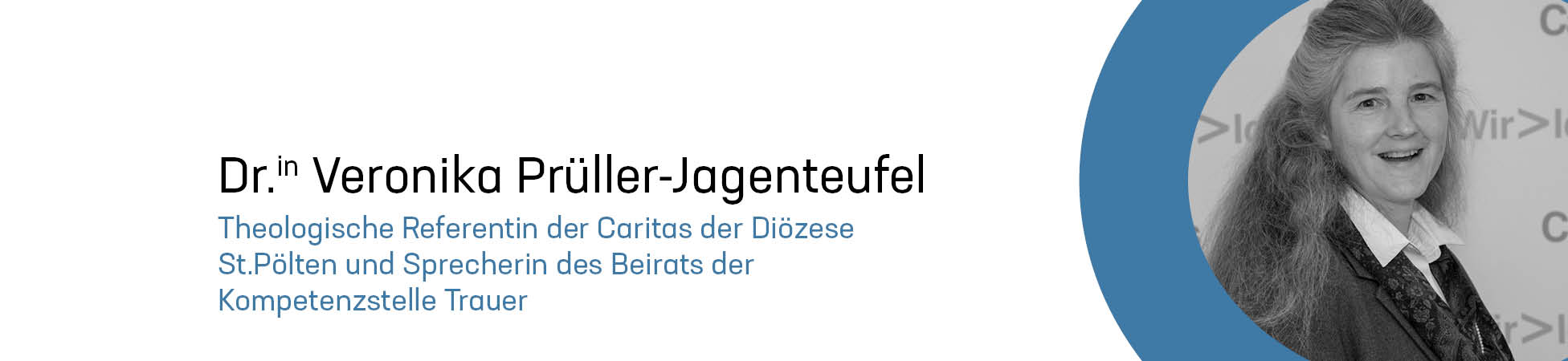
Dr.in Veronika Prüller-Jagenteufel ist theologische Referentin der Caritas St.Pölten und Sprecherin des Beirats der Kompetenzstelle Trauer. Sie hat Erfahrung in Seelsorge und geistlicher Begleitung sowie Kirchenentwicklung. Sie ist personzentrierte Beraterin und Demenzbegleiterin, Erwachsenenbildnerin und Pilgerbegleiterin. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. im Trägerverein des Freiwilligen Sozialen Jahres und im Katholischen Bildungswerk der Diözese St.Pölten.
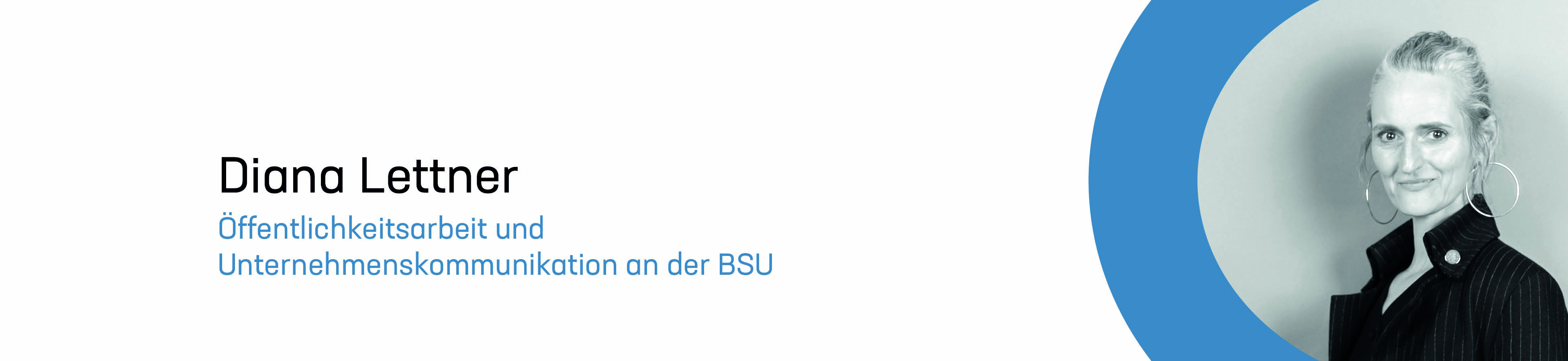
Diana Lettner ist im Bereich PR & Universitätskommunikation an der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten tätig. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf Agentur- und Unternehmensseite in Kommunikation, PR, Markenberatung und Moderation – unter anderem als ausgebildete Berufssprecherin, selbstständige Sprechtrainerin und Unternehmensberaterin. Zudem ist sie Erwachsenenbildnerin und Service Designerin mit den Schwerpunkten Team- und Innovationsentwicklung.
Moderation, Tag 2 der Suttnertage.
